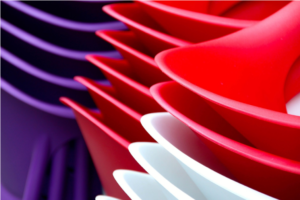Quelle: https://unsplash.com/de/fotos/9DSUwm1_N8k
Die deutsche Glücksspielregulierung gleicht seit Jahren einem Balanceakt auf dünnem Draht, gespannt auf dem Feld von Spielerschutz, Marktinteressen und der fast schon legendären Lust am Überregulieren. Mit dem Glücksspielstaatsvertrag von 2021 wurde der Versuch unternommen, Ordnung ins Chaos zu bringen oder zumindest den Eindruck zu erwecken, man habe es im Griff.
Doch das Regelwerk, das ursprünglich als Meilenstein gefeiert wurde, hat sich schneller als gedacht als löchriges Konstrukt entpuppt. Illegale Anbieter feiern fröhliche Urstände im Netz, während die legalen Plattformen unter zu engen Spielregeln und fragwürdiger Besteuerung ächzen. Nun regt sich politischer Druck, der aus dem bislang starren Vertrag ein flexibleres Werkzeug machen soll. Die entscheidende Frage lautet daher, ob die Reform noch vor 2026 kommt.
Die Politik erhöht den Druck – kommt die Reform früher als gedacht?
Der ursprüngliche Plan sah eine umfassende Evaluierung des Glücksspielstaatsvertrags im Jahr 2026 vor. Bis dahin sollte ausreichend Zeit bleiben, um Daten zu sammeln, Wirkungen zu analysieren und politische Maßnahmen zu überdenken. Doch diese Hoffnung hat sich verflüchtigt. Auf der Innenministerkonferenz im Juni 2025 wurde deutlich, dass sich die Länder nicht mehr auf Zeitspiel verlassen wollen.
Der Grund liegt auf der Hand. Der illegale Markt wächst rapide, die Glücksspielbehörde GGL stößt an ihre Grenzen und selbst staatliche Anbieter geraten zunehmend unter Zugzwang. Die neue Bundesregierung, getragen von CDU/CSU und SPD, hat das Thema in ihrem Koalitionsvertrag prominent platziert. Ziel ist es, den Glücksspielmarkt grundlegend neu zu ordnen, illegale Angebote zurückzudrängen und zugleich die legalen Betreiber zu entlasten.
Die Reform wird nicht nur diskutiert, sondern bereits vorbereitet und der politische Konsens wächst, dass das bestehende Regelwerk der Dynamik des Marktes nicht länger standhält. Es ist also nicht sicher, ob Spieler dann noch Plattformen ohne die deutsche Glücksspiellizenz nutzen können.
Das liegt auf dem Tisch
Die Reformpläne deuten darauf hin, dass die Politik bereit ist, grundlegende Strukturen zu verändern. Im Zentrum steht die technische Durchsetzung, allen voran das IP-Blocking. Bisher fehlte eine rechtlich saubere Grundlage, weshalb viele Seiten ohne deutsche Lizenz frei zugänglich blieben. Das soll sich nun ändern.
Darüber hinaus rücken sogenannte Intermediäre in den Fokus, also Plattformen, Provider und Werbenetzwerke, über die Glücksspielangebote verbreitet werden. Diese sollen in Zukunft zur Entfernung oder Sperrung illegaler Inhalte verpflichtet werden, sofern Verstöße erkennbar sind. Eine Haftungsregel, die bislang als Bremsklotz galt, soll aus dem Gesetz gestrichen werden. Damit könnten die Aufsichtsbehörden deutlich schlagkräftiger agieren.
Auch die GGL erhält neue Befugnisse. Künftig soll sie in der Lage sein, Informationen von ausländischen Regulierungsbehörden anzufordern. Diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit verspricht mehr Transparenz und Kontrolle bei der Vergabe und Überwachung von Lizenzen.
Allerdings bleibt ein heikler Punkt außen vor, denn die Werbung für Glücksspiele wird vorerst nicht weiter eingeschränkt. Trotz anhaltender Kritik warnt die Innenministerkonferenz vor pauschalen Maßnahmen, die rechtlich angreifbar wären. Vor allem das sogenannte Overblocking, das unbeabsichtigte Sperren legaler Inhalte, soll vermieden werden.
Ein Gerichtsbeschluss als Auslöser für die Reformwelle
Dass überhaupt Bewegung in die Sache kam, ist einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu verdanken. Im März 2024 gab das Gericht dem Anbieter Lottoland recht und entschied, dass IP-Sperren auf Grundlage des bisherigen Vertrags nicht zulässig seien. Damit wurde der zentrale Hebel der Behörden juristisch entmachtet.
Die Reaktion folgte prompt. Die GGL zeigte sich alarmiert, das Urteil entfaltete weitreichende Wirkung. Denn wenn selbst klare Rechtsverstöße technisch nicht unterbunden werden können, gerät nicht nur die Durchsetzung ins Wanken, sondern auch das Vertrauen in den Gesetzgeber. So wurde aus einem Urteil eine politische Zäsur, die das bisherige System infrage stellte.
Der Schwarzmarkt wächst und lässt sich kaum bändigen
Während Politik und Verwaltung an der Reform feilen, expandiert der illegale Markt munter weiter. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Im Jahr 2024 sollen rund 54 Prozent des deutschen Online-Glücksspielumsatzes auf nicht lizenzierte Anbieter entfallen sein. Der Marktwert lag bei etwa 4 Milliarden Euro. In bestimmten Sparten, etwa bei virtuellen Slots, dürfte der Anteil sogar deutlich höher gelegen haben.
Die Gründe sind vielfältig, aber keineswegs überraschend. Illegale Betreiber bieten oft ein breiteres Spielangebot, verzichten auf Einsatzlimits und ermöglichen deutlich schnellere Abläufe. Während lizenzierte Plattformen ihren Nutzern Zwangspausen und langwierige Spins vorschreiben, liefern ausländische Anbieter ein Spielgefühl ohne Bremse.
Hinzu kommt ein erheblicher Steuerunterschied. In Deutschland werden 5,3 Prozent Steuer auf den Einsatz erhoben, unabhängig vom Ausgang der Wette. Das benachteiligt seriöse Anbieter erheblich, da sie wirtschaftlich kaum mithalten können. Viele Spieler sehen die Einschränkungen im legalen Bereich nicht als Schutz, sondern als Hürde und orientieren sich entsprechend um.
Die Branche schlägt Alarm und fordert neue Spielregeln
Kritik kommt längst nicht nur von einzelnen Unternehmen, sondern wird von Verbänden wie dem DOCV und dem DSWV in konzentrierter Form vorgetragen. Der Casinoverband fordert eine Abkehr von der Einsatzsteuer zugunsten der Besteuerung des Bruttospielertrags, wie es international üblich ist. Dieses Modell ermögliche mehr Wettbewerbsfähigkeit und erhöhe die Chancen, den Schwarzmarkt zurückzudrängen.
Auch die geltenden Schutzmaßnahmen beim Spielen stoßen auf Widerstand. Das Einsatzlimit von einem Euro pro Dreh, lange Pausen und rigide Wartezeiten seien zwar gut gemeint, verfehlten jedoch oft ihre Wirkung. Statt für Sicherheit zu sorgen, drängten sie viele Spieler in den unregulierten Raum.
Nationale Grenzen reichen nicht – die europäische Perspektive im Blick behalten
Was in Deutschland beschlossen wird, muss sich in den Rahmen europäischer Gesetzgebung einfügen. Der Digital Services Act der EU fordert von Plattformbetreibern mehr Verantwortung bei der Entfernung illegaler Inhalte. Gleichzeitig betont er jedoch auch den Schutz legitimer Inhalte und rechtmäßiger Anbieter.
Wenn nationale Maßnahmen zu weit gehen, kann es passieren, dass legale Inhalte vorsorglich gesperrt werden. Genau davor warnen Unternehmen wie Google oder Meta. Sie verlangen präzise Regelungen, um nicht für jede rechtswidrige Werbung haftbar gemacht zu werden, die auf ihren Plattformen auftaucht.
Die GGL zeigt sich offen für europäische Kooperationen. Ohne diese Einbettung drohen Klagen, Verzögerungen oder gar die Aufhebung ganzer Regelwerke. Der digitale Binnenmarkt kennt keine Landesgrenzen, daher muss sich auch die Regulierung auf ein größeres Spielfeld einstellen.
Die Zukunft ist ungewiss, aber Reformen sind unvermeidlich!
Es bewegt sich etwas im deutschen Glücksspielrecht. Der politische Wille zur Neuausrichtung ist erkennbar, die Probleme liegen offen auf dem Tisch. Ob die geplanten Reformen ausreichen, um den Markt zu stabilisieren und den illegalen Angeboten Einhalt zu gebieten, bleibt abzuwarten. Viel wird davon abhängen, ob die Balance gelingt zwischen striktem Spielerschutz, attraktiven Rahmenbedingungen für Anbieter und einem rechtssicheren Vollzug. Bleibt der legale M